
- DAZ.online
- News
- Pharmazie
- Das Risiko der kleinsten ...
Nanopartikel
Das Risiko der kleinsten Dinge soll überschaubarer werden
Düsseldorf - 29.01.2016, 13:00 Uhr
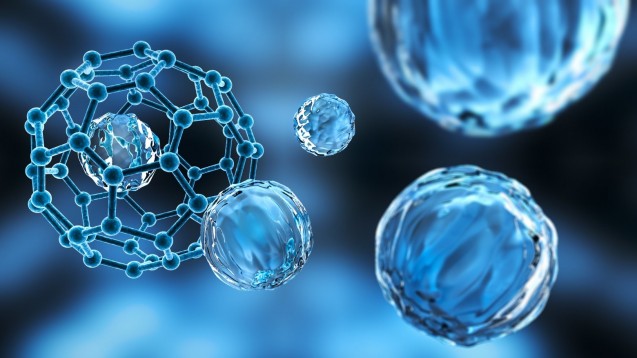
Die Effekte von Nanopartikeln sind noch kaum verstanden - obwohl sie zunehmend eingesetzt werden. (psdesign1 / Fotolia)
Auch in der Medizin gewinnt Nanotechnologie an Bedeutung. Damit das Risiko der kleinsten Partikel besser bewertet werden kann, versucht ein internationales Forschungsprojekt allgemeine Kriterien zu finden, wann Nanopartikel giftig sind.
Die Zukunft ist winzig klein. Im Bereich von 10-9 Meter, um genau zu sein, dem Nanometer. Und eigentlich ist die Zukunft auch schon längst allgegenwärtig, Nanotechnologie scheint beinahe ein alter Hut zu sein. Ob im Imprägnier Spray für Schuhe und Jacken, als Zusatzstoffe in Lebensmitteln, in Kosmetika, auf Dachziegeln und in Lacken oder auf Outdoor-Kleidung – künstliche industriell hergestellte Nanopartikel scheinen bereits überall zu sein. In der Apotheke begegnen sie Angestellten und Patienten dagegen noch selten – bisher eben hauptsächlich in Kosmetikprodukten oder in Form von Nanosilber auf Pflastern und Wundauflagen.
„Einer der größten Zukunftsmärkte und Wachstumsbereiche für den Einsatz von Nanomaterialien ist die Medizin“, sagt aber Andrea Haase, Mitarbeiterin der Fachgruppe Nanotechnologie am Bundesinstitut für Risikobewertung. Und einige Anwendungen gehen auch bereits rezeptpflichtig über die Ladentheke der Offizin. So etwa das Immunsupressivum Rapamune® oder das Mittel gegen Übelkeit Emend®, bei denen der in Wasser an sich schwer lösliche Wirkstoff als Nanopartikel in einer sogenannten Nanosuspension vorliegt.
Nanocarrier gewinnen an Bedeutung
Das Krebsmedikament Abraxane® ist ein weiteres, etwas anders geartetes Beispiel für eine Nano-Anwendung in der Medizin. Dabei ist der Wirkstoff Paclitaxel (Taxol) zum Transport an den Wirkort an winzige Transportmoleküle, Nanocarrier, gebunden. In diesem Fall handelt es sich um das Protein Albumin in Nanoform.
Und gerade bei den Nanocarriern könnte der Anteil medizinischer Nano-Anwendungen in Zukunft noch steigen, sagt Haase. „Insbesondere weckt der Bereich des gezielten Targetings große Hoffnungen. Man verspricht sich dadurch den zielgerichteten Transport eines Wirkstoffes in ein Zielorgan oder sogar eine Zielzelle“, erklärt die Expertin.
Während aber der Anteil der künstlich erzeugten winzigen Partikel im Alltag und zukünftig in der Medizin mit zum Teil großen Wachstumsraten stetig zunimmt, wächst auf der anderen Seite die Besorgnis über ungewollte Seiteneffekte der winzigen Teilchen. Im Jahr 2009 warnte etwa erstmals das Umweltbundesamt vor Nebenwirkungen der Nanopartikel. „Die Nanotechnologie ist eine noch vergleichsweise junge Technologie, so dass zwangsläufig noch viele Fragen offen sind“, erklärt Haase.
Über die Langzeitwirkung fast nichts bekannt
Nanopartikel unterscheiden sich in ihren Materialeigenschaften häufig grundlegend von herkömmlichen Materialien, sagt sie. Das macht sie einerseits für Forschung und Industrie gerade interessant. „Gleichzeitig bedingen diese neuartigen Eigenschaften aber auch Fragen nach möglichen Risiken“, sagt die Risikoforscherin. Vor allem fehle es häufig an Daten – insbesondere zur Langzeitwirkung von Nanopartikeln und darüber, wie sie sich im Organismus verteilen, also über die Biokinetik der Partikel.
Die Nanotoxikologie hat sich dazu seit einigen Jahren als Forschungszweig etabliert. Untersucht wird, wie giftig die Kleinstpartikel sich auf lebende Systeme auswirken. Die Forschung habe sich in diesem Bereich rasant entwickelt, viele unterschiedliche Projekte zur Nanosicherheitsforschung seinen etwa durch die EU gefördert worden, sagt Haase. Jedoch kritisieren manche Experten, dass nicht alle Ergebnisse und Studien dabei wirklich aussagekräftig seien. So fehle es zum Teil an Koordination in dem Forschungsgebiet.
Das könnte sich nun mit einem internationalen Forschungsprojekt ändern, dass die gesundheitliche Bewertung industriell genutzten Nanomaterials vereinfachen will. Mitte Januar 2016 trafen sich dazu Wissenschaftler aus aller Welt zur Auftaktveranstaltung des Projektes NanoToxClass im Bundeinstitut für Risikobewertung in Berlin. „Aktuell wird jede einzelne Nanopartikel-Variante experimentell getestet und hinsichtlich ihrer möglichen Risiken bewertet. Dies ist sehr zeit- und kostenintensiv“, erklärt Haase. Die Nanomaterialien in Gruppen einteilen und klassifizieren zu können, wie es mit dem Forschungsprojekt NanoToxClass beabsichtigt ist, würde somit vieles einfacher machen.
Größe allein macht die Partikel nicht toxisch
„Wir wissen heute, dass die Größe alleine keine besondere Toxizität bedingt“, sagt die Forscherin. Vielmehr hänge die Giftigkeit eines Nanopartikels von einer Kombination verschiedener Parameter ab. Die wichtigsten seien dabei die chemische Zusammensetzung und die Oberflächenbeschaffenheit sowie die Chemie an der Oberfläche der Partikel. „Diese Oberflächenchemie hat eine viel größeren Effekt auf die biologische Wirkung als zum Beispiel die Größe allein.“ Es fehle aber noch an systematischem Wissen, wie bestimmte Materialeigenschaften die Giftigkeit beeinflussen. Dies zu ändern, ist ein Ansatz des Forschungsprojekts, das mit 1,6 Millionen Euro aus Mitteln der Länder Deutschland, Belgien, Israel, Portugal und Rumänien gefördert wird.
„Bislang fehlt die wissenschaftliche Basis für eine Gruppierung der Nanopartikel“, erklärt Haase das Projekt. Ziel sei es nun, verlässliche Kriterien zu finden, anhand derer man die Ähnlichkeiten von Nanopartikeln beschreiben könne. Forschungsbedarf bestehe auch noch auf dem Gebiet der Wirkmechanismen. „NanoToxClass verwendet modernste Methoden der Systembiologie“, sagt die Forscherin weiter. So werde das Transkriptom, also die Gesamtheit der abgelesenen und in RNA übertragenen Gene, das Proteom, also alle in der Zelle vorhandenen Proteine, und das Metabolom, das ist die Gesamtheit aller verstoffwechselten Produkte, ausgewertet. Auf dieser Basis sollen dann die Wirkmechanismen der Nanopartikel charakterisiert werden. Biostatistik und Bioinformatik-Methoden sollen dann auf die erhaltenen Daten angewendet werden um mathematische Modelle für die Wirkung bestimmter Materialeigenschaften aufstellen zu können. „Das Projekt hat daher einen sehr grundlegenden und richtungsweisenden Charakter“, sagt Haase.
Nanopartikel von vorneherein sicherer entwerfen
Abgesehen davon, dass man sich so erhofft, in Zukunft Kosten sparen zu können, weil nicht mehr jedes neue Nanopartikel eigens aufwändig getestet werden muss, hofft man so auch, dann Nanopartikel von Grund auf sicherer und zielgerichteter entwickeln zu können. „Das Wissen darum, welche Eigenschaften zu einer bestimmten Eingruppierung führen, erlaubt es, sie auch bei der Materialentwicklung einzusetzen“, sagt Haase. Man können so bestimmte Materialeigenschaften von vorneherein vermeiden und erhalte Partikel, die „Safe by design“ seien, also von vorneherein sicherer entworfen.
Mit den Ergebnissen dieser Forschung, so sind sich die Experten sicher, könnte sich dann das Tempo beschleunigen, mit dem Nanopartikel auch im Bereich Medizin an Bedeutung gewinnen. Arzneimittel auf Nanobasis könnten dann vielleicht eher zur Regel in der Apotheke werden, statt die Ausnahme zu sein.





















0 Kommentare
Das Kommentieren ist aktuell nicht möglich.