
- DAZ.online
- DAZ / AZ
- DAZ 36/2023
- Wann ist etwas bioä...
Arzneimittelzulassung
Wann ist etwas bioäquivalent?
Ein Update der Grundlagen des Bioäquivalenzkonzeptes
Die Qualität von Arzneimitteln ist für die medikamentöse Therapie von zentraler Bedeutung. Eine kritische Auseinandersetzung mit qualitätssichernden Maßnahmen ist äußerst wichtig, sollte sich aber auf wissenschaftlich belegte Fakten stützen. Eine nicht sachgerechte Kritik, die nur von Behauptungen bzw. persönlichen Einschätzungen ausgeht, kann sogar schädlich sein, weil sie zu einer Verunsicherung der Apothekerinnen und Apotheker und damit letztlich auch der Patientinnen und Patienten führen könnte. In diesem Update sollen die Kernelemente des Bioäquivalenzkonzeptes herausgearbeitet werden: Welche primären Ziele werden verfolgt? Haben sich die Methoden bewährt? Welche Schlussfolgerungen können aus dem Nachweis der Bioäquivalenz für die Anwendung wirkstoffgleicher Fertigarzneimittel gezogen werden?
Grundsätzlich geht es bei Bioäquivalenzstudien um den Nachweis, dass sich zwei wirkstoffgleiche Fertigarzneimittel mit „vergleichbaren“ Darreichungsformen bei Anwendung unter identischen Applikationsbedingungen analog verhalten und den enthaltenen Wirkstoff in gleichem Ausmaß und mit analoger Geschwindigkeit zur Resorption freisetzen. Was vergleichbare Darreichungsformen sind, wird von den Zulassungsbehörden unterschiedlich bewertet. So werden z. B. in der Europäischen Union Tabletten und Kapseln als vergleichbar angesehen, während die amerikanische Zulassungsbehörde Food and Drug Administration (FDA) dies so nicht akzeptiert.
Für den Vergleich der Bioverfügbarkeit zwischen wirkstoffgleichen Fertigarzneimitteln (z. B. einem „Originalpräparat“ mit vollständiger klinischer Dokumentation und seiner generischen Alternative) gelten eine Reihe von Paradigmata:
- Ziel der Untersuchungen ist das Aufdecken möglicher für die Bioverfügbarkeit relevanter Produktunterschiede.
- Es werden die Präparate unter identischen Einnahmebedingungen verglichen.
- Eine Übertragung der dabei erhaltenen Ergebnisse auf abweichende Anwendungsbedingungen ist in den meisten Fällen nicht zulässig.
- Grundlage für eine Entscheidung über die Bioäquivalenz ist der intraindividuelle Vergleich der Ergebnisse bei allen Probanden (Ausnahme: Parallelgruppen-Studien).
- Die Ergebnisse der intraindividuellen Vergleiche gelten als übertragbar
- von gesunden Probanden auf Patienten als eigentliche Zielpopulation.
- von Männern auf Frauen bzw. umgekehrt.
- von in die Studie einbezogene jüngere Probanden auf ältere Personen.
Da diese Eckpfeiler des Bioäquivalenzkonzeptes nicht in allen Fällen bei der Interpretation von Bioäquivalenzstudien und der Beurteilung der Konsequenzen für die praktische Therapie adäquat berücksichtigt werden, sollen sie noch einmal näher betrachtet und anhand von einigen Beispielen erläutert werden.
Bioäquivalenz bedeutet vergleichbares In-vivo-Verhalten
Entscheidend für die Resorption von Arzneistoffen aus festen Darreichungsformen nach deren peroraler Applikation sind vor allem
- die Wirkstofffreisetzung aus den Produkten,
- die Verweildauer der Arzneiformen im Magen sowie
- die Geschwindigkeit der anschließenden Darmpassage.
Dabei können unterschiedliche pH-Wert-Verhältnisse die Löslichkeit der Wirkstoffe und deren Freisetzung aus den Arzneiformen signifikant verändern. Letztlich sind die im Plasma analysierten Konzentration-Zeit-Profile die Resultante aller dieser Prozesse. Nur wenn die Wirkstoffauflösung in Magen und Darm und die anschließende Resorption nach Einnahme beider Präparate mit gleicher Geschwindigkeit verlaufen, sind weitgehend deckungsgleiche Plasmaprofile zu erwarten, die eine Voraussetzung für einen positiven Bioäquivalenzbeleg sind.
Solange die biopharmazeutischen (Löslichkeit und Freisetzung aus den Tabletten) und physiologischen Bedingungen (Magen-Darm-Transit und pH-Wert-Verhältnisse in den einzelnen Bereichen) zwischen verschiedenen Personengruppen (z. B. Männern und Frauen, Jungen und Alten sowie Gesunden und Patienten) nicht signifikant unterschiedlich sind, wird davon ausgegangen, dass die Prüfpräparate sich auch in der jeweils anderen Population ähnlich verhalten und daher eine Bioäquivalenz angenommen werden kann.
Bei bestimmten pathophysiologischen Konditionen dagegen, aber auch in Fällen bestimmter Begleitmedikationen kann es sein, dass diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind. So werden bei Patienten unter Therapie mit Protonenpumpeninhibitoren (PPI) im Vergleich zu gesunden Probanden deutlich abweichende pH-Werte im Magen resultieren. Nach Einnahme von Arzneistoffen mit pH-Wert-abhängiger Löslichkeit kann dann die Bioverfügbarkeit signifikant abweichen. Auch diese Einschränkung wird jedoch durch die in den modernen Bioäquivalenz-Guidelines festgelegten Anforderungen berücksichtigt. So werden im Entwurf für die ICH M13-Guideline (s. Blume H. Diskussion der Bioäquivalenz-Leitlinie: „Open Forum“ zur Harmonisierung der Anforderungen für die Zulassung von Humanarzneimitteln. DAZ 2023, Nr. 28, S. 60) bei entsprechenden Wirkstoffen zusätzliche Bioäquivalenznachweise unter PPI-Einfluss gefordert.
Bioäquivalenz – ein Problem (mit) der Statistik?
Seit der Einführung des Bioäquivalenzkonzeptes werden immer wieder die Akzeptanzgrenzen von 80 bis 125% als Maß für die maximal tolerierten (theoretischen) Abweichungen zwischen Test- und Referenzpräparat kritisiert. Diese werden als ungeeignet – da zu wenig restriktiv – eingestuft, um zwischen den Produkten tatsächlich therapeutische Äquivalenz sicherstellen zu können. Ein Argument, das von forschenden Pharmaunternehmen bei Patentablauf und Einführung der Generika zur Verteidigung ihrer Produkte gegen die generische Konkurrenz bisweilen vorgebracht wird. Diese Kritik erscheint bei oberflächlicher Betrachtung einleuchtend. Der Vorschlag, die Bioäquivalenzentscheidung durch Berechnung der 90%-Konfidenzintervalle für den intraindividuellen Vergleich zu begründen und für die Berechnung Akzeptanzgrenzen von 80 bis 125% anzuwenden, wurde 1972 von dem amerikanischen Mathematiker J. W. Westlake ohne eine medizinische Grundlage eingebracht. Trotzdem wurde dieses Konzept weltweit in alle relevanten Guidelines aufgenommen und hat sich für die Zulassung von Generika bewährt.
Warum ist das so? Zunächst einmal ist wichtig, dass durch diese Grenzwerte nicht etwa Abweichungen von bis zu 45% (entsprechend der Spanne zwischen 80% und 125%) in der Bioverfügbarkeit zwischen den Präparaten akzeptiert würden. Diese Limits gelten vielmehr für die 90%-Vertrauensbereiche, deren Ausdehnung vor allem durch die intraindividuelle Variabilität der betrachteten Parameter – hier AUC und Cmax – bestimmt wird. Die Konfidenzintervalle markieren dann den Bereich, in dem mit 90%iger Wahrscheinlichkeit der „wahre“ Wert liegt. Diese Wahrscheinlichkeit ist in der Mitte des Intervalls am größten und sinkt zu dessen Grenzen signifikant.
Und noch ein weiterer Aspekt ist zur richtigen Einordnung möglicher therapeutischer Konsequenzen wichtig: Bei den meisten Arzneistoffen wird im oberen, flachen Teil der sigmoidalen Dosis-Effekt-Beziehung therapiert. Hier aber wirken sich dann gewisse Abweichungen in der Bioverfügbarkeit (und damit der de facto „wirksamen“ Dosis) nur eher marginal auf den erreichten therapeutischen Effekt aus. Dies gilt natürlich nicht für Arzneimittel mit enger therapeutischer Breite, bei denen die erforderliche Dosierung im steilen Bereich der Dosis-Effekt-Beziehung liegt und daher sich bereits kleinere Unterschiede in der Bioverfügbarkeit erheblich auf die therapeutischen Effekte auswirken würden. Daher wird für solche Präparate ein engerer Akzeptanzbereich (z. B. 90 bis 111%) für den Bioäquivalenzbeleg festgelegt. Für viele Arzneistoffe bzw. verschiedene Indikationsgruppen wurde mithilfe systematischer Untersuchungen die therapeutische Vergleichbarkeit von Generika und den jeweiligen Originalprodukten gezeigt, z. B. für Statine [1], Antipsychotika und Antidepressiva [2|, kardiovaskuläre Arzneimittel [3, 4] oder in einer Übersichtsarbeit ohne Indikationsbeschränkung [5].
Bioäquivalente Generika und trotzdem Probleme beim Präparatewechsel?
Trotz sorgfältiger Überprüfung der vorgelegten Bioäquivalenznachweise durch die Behörden bei der Zulassung von Generika gibt es immer wieder Berichte über therapeutische Veränderungen im Zusammenhang mit einer generischen Substitution, und zwar nicht nur beim Umstieg vom „Original“ auf ein Generikum, sondern auch beim Wechsel zwischen Generika. Solche Probleme werden auch in einer der eingangs erwähnten Publikationen gezeigt.
Und wie ist die Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Generika zu beurteilen? Auch diese Frage wurde bereits intensiv diskutiert. Natürlich wird bei allen generischen Arzneimitteln im Rahmen der Zulassung Bioäquivalenz jeweils nur im Vergleich zum Originator verlangt und nicht für die Vergleiche mit anderen Generika. Trotzdem ist in der Praxis das Risiko einer fehlenden Bioäquivalenz zwischen einzelnen zugelassenen Generika eher gering, wie aus den oben zitierten systematischen Studien [1–5] hervorgeht.
Auf einer internationalen Konferenz in den USA wurde von Mitarbeitern der FDA von einer umfangreichen internen Recherche anhand von mehr als 1000 dokumentierten Zulassungsanträgen berichtet. Diese ergab, dass die maximale Abweichung in der mittleren Bioverfügbarkeit („Punktschätzer“) nicht mehr als 4 bis 5% betrug und noch zu einem positiven Beleg der Bioäquivalenz führte.
Die Einführung der Bioäquivalenz als Voraussetzung für die Zulassung von Generika [6] hat zu einer wesentlichen Verbesserung der Therapiesicherheit geführt. Auf diese Weise konnten vermutlich therapeutische Katastrophen vermieden werden, wie sie zuvor z. B. in Australien von Digoxin-Generika unterschiedlicher Formulierung berichtet wurden [7]. Auch für Phenytoin-Tabletten wurde bereits Ende der 1970er-Jahre über Probleme durch Veränderungen der Bioverfügbarkeit nach Reformulierung berichtet [8]. Wenn von einzelnen Patienten therapeutische Abweichungen bei einer generischen Substitution berichtet werden, sollten mögliche Ursachen sorgfältig überprüft werden. Solche Berichte konnten in der Vergangenheit in breit angelegten Studien nicht bestätigt werden [1 – 5]. Ein relevanter, aber nur schwer zu verifizierender Grund könnte möglicherweise in Abweichungen der Qualität der betreffenden Produktionscharge(n) am Markt von dem im Rahmen der Zulassung untersuchten „Prototyp“ des Arzneimittels bestehen. Diese Übereinstimmung ist jedoch ein entscheidender Grundpfeiler der Zulassung, denn nur wenn dies sichergestellt wird, kann auch für alle späteren Marktchargen Bioäquivalenz angenommen werden. Diese Übereinstimmung wird mit Hilfe von In-vitro-Tests überprüft, jedoch fehlen in vielen Fällen valide Belege dafür, dass die festgelegten Spezifikationen hierfür ausreichend prädiktiv sind. Möglicherweise sind manche in Vergleichsstudien am Markt festgestellten Qualitätsabweichungen als Indikator dafür zu werten, dass nicht in allen Fällen auf diese Weise Bioäquivalenz für alle späteren Produktionschargen gewährleistet werden kann.
Auf einen Blick
- Durch den im Rahmen der Zulassung von Generika weltweit geforderten Nachweis der Bioäquivalenz wird sichergestellt, dass sich die Prüfpräparate (Innovator-Produkt mit vollständiger klinischer Dokumentation und seine generische Alternative) bei gleichen Anwendungsbedingungen analog verhalten und den Wirkstoff in gleichem Ausmaß und mit identischer Geschwindigkeit zur Resorption freisetzen. Dadurch sollte therapeutische Äquivalenz gewährleistet sein.
- Diese Schlussfolgerung kann in der Praxis nur gezogen werden, wenn die Anwendungsempfehlungen korrekt eingehalten werden und nicht eventuell andere Bedingungen herrschen (z. B. die Einnahme nach dem Essen, obwohl Nüchternapplikation empfohlen wird).
- Bei der statistischen Bioäquivalenzbewertung wird der intraindividuelle Vergleich an einer begrenzten Anzahl von gesunden Probanden (z. B. 24, 36 oder 48) zugrunde gelegt. Der recht weit erscheinende Akzeptanzbereich von 80 bis 125% hat sich in der Praxis bewährt, vor allem, weil aus gewissen Unterschieden in der Bioverfügbarkeit nicht direkt auf entsprechende Abweichungen in Wirksamkeit oder Sicherheit der Arzneimittel geschlossen werden kann.
- Es gibt über die Beurteilung durch die Zulassungsbehörden hinaus noch weitere Belege für die Relevanz des Bioäquivalenzkonzeptes in der Praxis [1 – 5]. Die in zahlreichen Studien und Metaanalysen gezeigte therapeutische Gleichwertigkeit betrifft nicht nur direkte Vergleiche zwischen Originator und generischen Alternativen, sondern sie gilt auch für verschiedene Generika untereinander – obwohl es für diese Vergleiche keinen Beleg der Bioäquivalenz gibt.
Bioäquivalenz – ein „bereits dokumentiert gescheitertes System“?
Die in einem der eingangs erwähnten Artikel ohne Belege aufgestellten Hypothese, die Bioäquivalenz sei ein „aus Sicht der Wissenschaft ein … dokumentiert gescheitertes System“, wird durch die Fachleute auf diesem Gebiet nicht geteilt. Schon allein die Tatsache, dass derzeit an der ersten weltweit gültigen Guideline für Bioäquivalenzstudien als Grundlage für die Zulassung generischer Arzneimittel gearbeitet wird (ICH M13A), zeigt, dass die zuständigen Gesundheitsbehörden, aber auch die Experten aus Hochschule und Industrie das Bioäquivalenzkonzept als relevant erachten.
Kontrollierte Studien oder Metaanalysen mit wirkstoffgleichen Präparaten, bei denen trotz belegter Bioäquivalenz eine abweichende therapeutische Wirksamkeit nachgewiesen wurde, sind uns dagegen nicht bekannt. Bei allen anderslautenden Berichten handelt es sich entweder um Patientenbefragungen oder Darstellungen von Einzelfällen, die zwar wichtig sind, aber einen nur geringen Evidenzgrad haben. Sollte es tatsächlich solche Belege aus kontrollierten Studien geben, dann müssen diese unmittelbar zu regulatorischen Konsequenzen in Form von Marktrücknahmen der betreffenden Produkte führen. Einzelne solcher Maßnahmen sind in der Literatur zu finden, z. B. für Bupropion (Budeprion) in den USA [9].
Angesichts dieser Situation ist bemerkenswert, dass in manchen medizinischen Fachjournalen von Meinungsbildnern in Editorials trotzdem vor einer generischen Substitution gewarnt wurde. Dies hat in der Folge intensive Diskussionen in den Fachkreisen hervorgerufen und die Zulassungsbehörden zur Überprüfung ihrer Vorgehensweise veranlasst. Am Ende dieser Prozesse stand jedoch stets die erneute Bestätigung der Tragfähigkeit des Bioäquivalenzkonzeptes.
Fazit
Das Bioäquivalenzkonzept wird weltweit als Voraussetzung für die Zulassung von Generika zugrunde gelegt und hat sich seit Jahrzehnten bewährt. Daher wird es auch unverändert in der neuen ICH M13-Guideline für die globale Harmonisierung der Zulassungskriterien fortgeschrieben. Wenn die regulatorischen Fachleute auf diesem Gebiet den Bioäquivalenzansatz tatsächlich als gescheitert ansehen würden, wäre dies sicherlich nicht der Fall.
Man kann sich fragen, welche Motivation hinter nicht durch Fakten unterlegten Aussagen, die den Bioäquivalenzansatz infrage stellen, stehen mag. Sie tragen nicht zur Bereicherung der Diskussion bei, sondern führen nur zur Verunsicherung der für die medikamentöse Therapie von Patienten in der Praxis Verantwortlichen.
Eine wichtige Konsequenz sollte aber die Forderung sein, dass die Anstrengungen zur Sicherstellung der Äquivalenz späterer Produktionschargen mit der Qualität/Bioverfügbarkeit des zugelassenen Prototyps noch verstärkt werden. Hierfür wären In-vivo-relevante Freigabespezifikationen für die Qualitätskontrolle später für den Markt produzierter Chargen erforderlich, deren konsequente Etablierung allerdings nicht einfach erscheint. Dies wäre zwar nicht unmittelbarer Bestandteil des Bioäquivalenzkonzeptes, würde aber wesentlich dazu beitragen, die Schlussfolgerungen aus dem Nachweis der Bioäquivalenz im Rahmen der Zulassung in die therapeutische Praxis umzusetzen. |
Literatur
[1] Corrao G et al. Are generic and brand-name stiatins clinically equivalent? Evidence from a real data-base. Eur J Intern Med 2014;25:745-750
[2] Cessak G et al. Therapeutic equivalence of antipsychotics and antidepressants – A systematic review. Pharmacological Reports 2016;68:217-223
[3] Kesselheim AS et al. Clinical Equivalence of Generic and Brand-Name Drugs Used in Cardiovascular Disease: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA 2008;300:2514-2526
[4] Manzoli L et al. Generic versus brand-name drugs used in cardiovascular diseases. Eur J Epidemiol 2016:31;351-368
[5] Desai RI et al. Comparative effectiveness of generic and brand-name medication use: A database study of US health insurance claims. PLoS Med 2019;16(3):e1002763, https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002763
[6] Carpenter D, Tobbel DA. Bioequivalence: The Regulatory Career of a Pharmaceutical Concept. Bull Hist Med 2011;85:93-131
[7| Danon A et al. An outbreak of digoxin intoxication. Clin Pharmacol Ther 1977;21:643-646
[8] Neuvonen PJ, Bardy A, Lehtovaara R. Effect of increased bioavailability of phenytoin tablets on serum phenytoin concentration in epileptic out-patients. Br J Clin Pharmacol 1979;8:37-41
[9] Woodcock J, Kahn M, Yu LX. Withdrawal of Generic Budeprion for Nonbioequivalence. N Engl J Med 2012;367;26:2463-2465

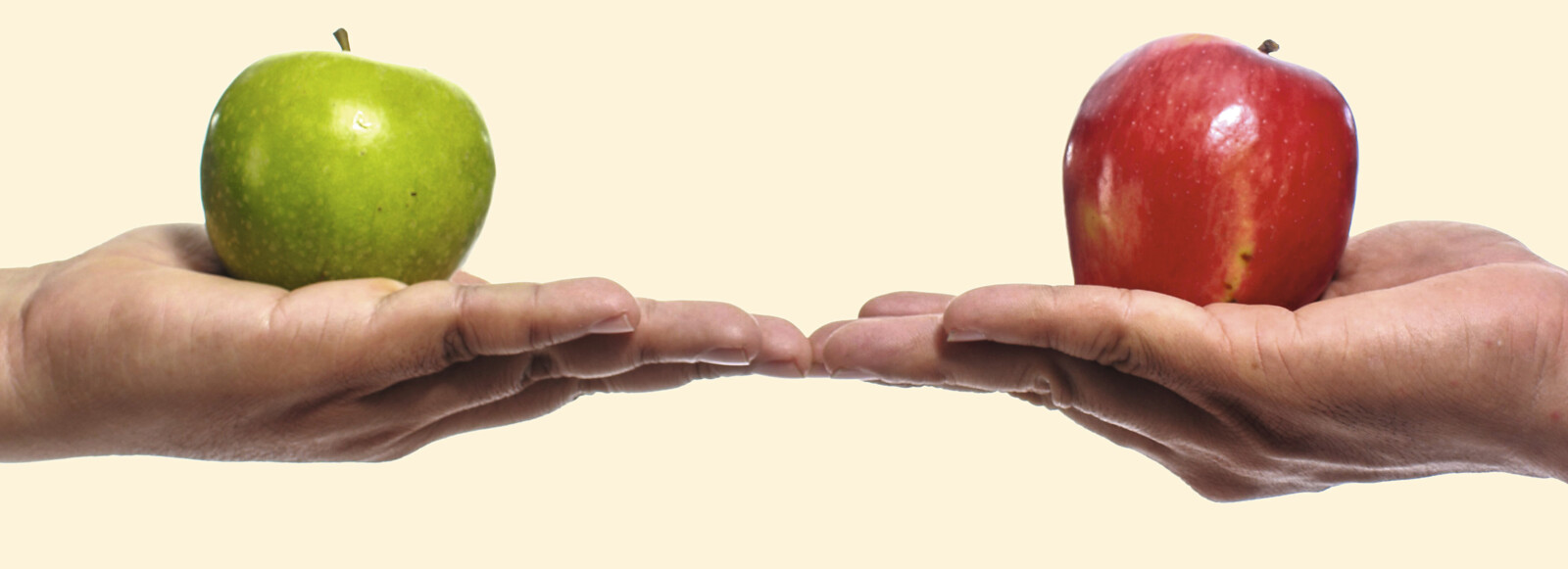
























0 Kommentare
Das Kommentieren ist aktuell nicht möglich.