
- DAZ.online
- DAZ / AZ
- DAZ 8/2012
- Psychisch kranke ...
Arzneimittel und Therapie
Psychisch kranke Jugendliche
Strategien bei Depression, Zwang und Psychose
Dies wurde auf einem Symposium zur psychotherapeutischen Behandlung im Übergang vom Jugend- in das Erwachsenenalter auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) Anfang Dezember 2011 in Berlin diskutiert.
Die Lebenszeitprävalenz der Depression liegt zwischen 15 und 25%. Schon bei den Kindern leiden 2% unter einer depressiven Störung, bei den Jugendlichen steigt die Häufigkeit auf 4 bis 8%. Trifft es bei den Kindern noch Jungen und Mädchen gleichermaßen, erkranken im Jugendalter, wie auch später bei den Erwachsenen, Frauen doppelt so häufig. Komorbiditäten wie Angst und Sucht sind häufig, erläuterte Wolfgang Ihle, psychologischer Psychotherapeut am Institut für Psychologie der Universität Potsdam. In der Prävention und Therapie unipolarer Depressionen sind psychotherapeutische Maßnahmen wirksam, betonte er. Sie zeigen langfristig stabile Effekte und sind "Pseudogruppen" überlegen. Dabei verwies er auf eine Metaanalyse, die sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern und Jugendlichen eine mittlere Effektstärke feststellte. Der größte Erfolg lässt sich laut Ihle mit einer kognitiven Verhaltenstherapie (KVT) erreichen, als Einzel- oder als Gruppentherapie. Dabei gilt: Je jünger das Kind, umso wichtiger die Einbeziehung von Eltern und Familie. Weiter verbessern lässt sich der Effekt durch eine zusätzliche medikamentöse Intervention.
Zwangsstörungen oft vor dem 15. Lebensjahr
Weit seltener als Depressionen sind Zwangsstörungen mit einer Lebenszeitprävalenz von 2 bis 3%. Die Hälfte tritt bereits vor dem 15. Lebensjahr auf, bei Jungen etwas häufiger als bei Mädchen. Sie führen zu Beeinträchtigungen im familiären, sozialen und schulischen Kontext und zu einer deutlich schlechteren Lebensqualität. Zudem korreliert der frühe Beginn langfristig mit einem schlechteren Behandlungserfolg, erläuterte Dr. Britta Jäntsch, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie in Heidelberg. Bei Verdacht auf eine Zwangsstörung müssen organische Ursachen, eine geistige Behinderung, Autismus, Depression und Schizophrenie differentialdiagnostisch abgeklärt werden. Lang ist auch die Liste möglicher Komorbiditäten wie affektive Störungen, Tics, Persönlichkeitsstörungen und ADHS bis hin zu Essstörungen und zwanghaftem Betreiben von Sport. Zwangsstörungen sind oft schambesetzt. Jäntsch plädierte deshalb dafür, nach einem ersten Gespräch unter Einbeziehung der Eltern mit dem Jugendlichen allein zu sprechen. Lehrer oder andere Bezugspersonen können gegebenenfalls einbezogen werden um die Entwicklungsgeschichte zu erkunden.
Expositionsbehandlung mit Reaktionsverhinderung
Für die Therapie von Zwangsstörungen in frühen Lebensjahren hat die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie im Jahr 2007 Leitlinien herausgegeben (www.awmf-online.de), die eine Orientierung ermöglichen. Laut Jäntsch sind Beratung und Aufklärung über mögliche Ursachen ebenso wichtig wie eine familienzentrierte Intervention, wenn das häusliche Umfeld den Zwang unterstützt. Klassisches Modell für die Therapie einer Zwangserkrankung ist die Expositionsbehandlung mit Reaktionsverhinderung. Dabei wird der Patient mit dem Reiz konfrontiert, das übliche Vermeidungsritual verhindert. Hat er beispielsweise Angst sich zu beschmutzen, muss er lernen Schmutz auszuhalten. Die Exposition sollte auch im häuslichen Umfeld durchgeführt werden, wobei die Rolle der Eltern genau zu definieren ist. Bei zwangsinduzierten Gedanken kann beispielsweise eine Veränderung der Bewertung durch kognitive Umstrukturierungen des Bewertungsmusters, "Gedankenstopp" und Selbstinstruktionstraining helfen. Jäntsch verwies auch auf medikamentöse Therapieansätze, die für Kinder und Jugendliche geeignet sind, wie Clomipramin, SSRI und die Augmentation vor allem mit atypischen Neuroleptika. Dabei muss immer das jeweilige Nebenwirkungsspektrum im Auge behalten werden.
Psychoseferne und psychosenahe Prodrome
Eine Schizophrenie manifestiert sich meist zwischen dem 15. und 35. Lebensjahr, fällt also ebenfalls häufig in das Jugendalter, zumal die meisten Patienten vor dem ersten psychotischen Ereignis eine Prodromalphase erleben, die über Jahre dauern kann, erläuterte Professor Dr. Joachim Klosterkötter vom Zentrum für Neurologie und Psychiatrie am Universitätsklinikum Köln. Hinweis auf die Entwicklung einer Schizophrenie sind psychoseferne Prodrome, die etwa fünf Jahre vor dem ersten psychotischen Ereignis auftreten. Dazu gehören Gedankeninterferenzen, Störungen der rezeptiven Sprache, Gedankenjagen, Gedankenblockade oder auch akustische und optische Wahrnehmungsstörungen, die mehrfach über einen Zeitraum von mindestens einer Woche auftreten. Zu psychosenahen Prodromen kommt es etwa ein Jahr vor dem ersten psychotischen Ereignis. Während der Prodromalphase zeichnen sich zudem bereits soziale Defizite ab. Dieses Beschwerdebild ist für den Patienten und dessen Angehörige sehr belastend. Bei psychosefernen Symptomen bei entsprechender prädiktiver Basissymptomatik oder auch einem Leistungsabfall bei erhöhtem Risiko für eine Schizophrenie (familiär bedingt oder durch prä- und perinatale Komplikationen) empfahl Klosterkötter eine psychologische Intervention. Hier gebe es inzwischen gute Daten für die Wirksamkeit der kognitiven Verhaltenstherapie. Bei psychosenaher Symptomatik mit kurzzeitig intermittierenden psychotischen Symptomen oder attenuierter Positivsymptomatik ist eine pharmakologische Intervention indiziert.
Apothekerin Dr. Beate Fessler





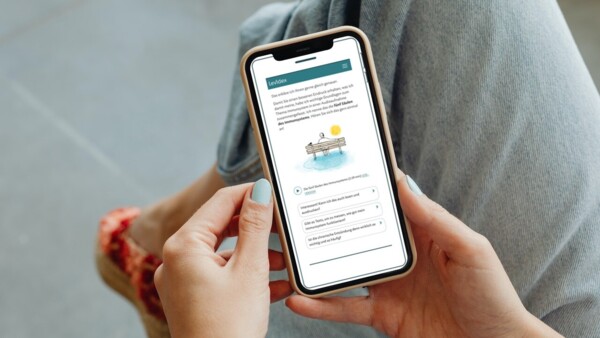





















0 Kommentare
Das Kommentieren ist aktuell nicht möglich.